Hier wollte ich ursprünglich hier über zwei Personen berichten, deren Biographien mich seit einiger Zeit beschäftigen; zwischendurch vielseitig abgelenkt, müssen Fr.K. Hornemann (1772-1801) u. J.Fr. Ruthe (1788-1859) jetzt noch ein wenig warten.
Dienstag, 25. Oktober 2011
Spieglein, Spieglein …
Sonntagmorgens, beim gemütlichen Hantieren mit Rasierschaum und Klinge, überfiel mich unversehens ein schwerwiegendes Problem. Warum verwechselt der Spiegel eigentlich die Seiten meines stoppelbärtigen Gesichts? Die rechte Wange wird im Spiegel zur linken und die linke zur rechten. Der Spiegel vertauscht offenbar rechts und links; sollte er dann nicht ebenso oben und unten umkehren?
Warum tut er das aber ganz offensichtlich nicht?
Fragen sind manchmal wie durch belanglose Musik aus dem Radiowecker angeregte Ohrwürmer. Sie geistern eine zeitlang unentwegt im Kopf herum, lassen sich nicht ignorieren. Fragen verlangen schlüssige Antworten. Dann erst geben sie Ruhe.
Noch einmal zurück zum Spiegel: ist vollkommen eben. Wenn er meine rechte und linke Seite vertauscht, warum bleibt das Oben oben?
Das Rechts-Links-Problem verwirrt meine Hirnwindungen. Jetzt bin ich mit der Rasierklinge ans Ohrläppchen geraten. Es blutet. Für Sekunden tritt die Rechts-Links-Frage in den Hintergrund. Einen Moment nur, dann meint der fragende Ohrwurm:
Wenn Radioastronomen künftig einmal Signale von intelligenten Außerirdischen empfangen und mit jenen fernen Wesen kommunizieren sollten, wie erklären sie ihnen unser rechts und links?
Ein möglicher Funkdialog:
"Erdling, was meinst du mit links?"
"Links ist da, wo Dein Daumen rechts ist."
"Alle meine drei Daumen sind grün, kein einziger ist rechts."
Das würde also nicht zum Ziel führen! oben und unten wäre viel einfacher zu erklären. Da hilft die im gesamten All wirkende Schwerkraft. Auch auf anderen Planeten landet ein herabfallendes Marmeladenbrot immer mit der belegten Seite auf dem Teppich. Also könnte man dem grünen Männchen leicht erklären: Unten ist dort, wo das Marmeladenbrot landet, nach dem es oben den Halt verlor.
Das Oben-Unten-Problem ist lösbar.
Es macht durchaus Sinn, spiegelbildliche Seiten unterschiedlich zu benennen. Wir Erdenbürger einigten uns auf die Wörter rechts und links. Die Wortbedeutungen zu definieren gelingt allerdings nur bei einen eindeutigen Bezugspunkt. Der muss im Gespräch von beiden Komunikanten sichtbar sein. Sonst kann man nicht erklären, was als rechte bzw. linke Seite einer Symmetriehälfte bezeichnen. Schließlich sind beide Seiten irgendwie gleich, nicht anders unterscheidbar als durch die vereinbarte willkürliche Benennung.
Symmetrie wird zumeist als angenehm empfunden. Sie schafft Gleichgewicht, einen Ausgleich zwischen Gegensätzen. Rechte und Linke, das sind eigene Welten, unterschiedlich wie das da oben und jenes da unten. Nur viel schwieriger zu vermitteln.
Alles ist gleich, nur andersherum, stellte Alice fest, als sie durch den Spiegel in eine andere Welt trat. Alles ist austauschbar. Ich benenne: rechts und links, unten und oben, Nord und Süd, arm, und reich. Welche Bedeutung messe ich diesen Gegensätzen bei? – und wie steht es mit den beiden Begriffen Leben und Tod? – Wenn uns manche Religionen glauben machen, es gäbe ein Weiterleben nach dem Tod, verwischen sie die Unterschiede, zeichnen Trugbilder wie mein Rasierspiegel.
Alltags finde ich beim Rasieren keine Zeit für solche Gedanken. Ob ich am kommenden Sonntag erneut gedankenvoll mein Spiegelbild betrachte – oder die Augen vor der Wirklichkeit verschließen werde? Wahrscheinlich werde ich fragen, sehe ich überhaupt die Wirklichkeit, und wenn ja, welche?
Am Frühstückstisch versuche ich mein Problem zum Gesprächsthema zu machen.
„Mich interessiert , warum der Spiegel nur rechts und links, nicht aber auch oben und unten vertauscht!“
„Weil du sonst deine Beine rasieren würdest!“
Die Antwort lässt mich das schrinnende Ohrläppchen vergessen. Blutete eigentlich das rechte oder das linke?
Montag, 3. Oktober 2011
Heinrich Adolph (1836-1914)
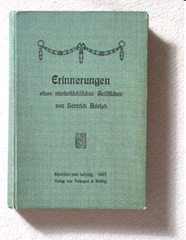
In seiner Autobiographie 'Erinnerungen eines niedersächsischen Geistlichen' schildert Pastor Adolph authentische Bilder von lokalhistorischer Bedeutung. Nordstemmen, Hildesheim, besonders aber Heinde und dessen Nachbarorte sind in diesem Zusammenhang zu nennen, auch Vienenburg und ebenso Heiligenfelde bei Syke; nicht zu vergessen sind Himbergen in der Lüneburger Heide sowie Adolphs Studienorte Loccum und Göttingen.
Seine Erinnerungen, 1907 als Buch erschienen, lenken die Blicke des interessierten Lesers auf sozial- und kirchengeschichtliche Wandlungen des 19. Jahrhunderts.
Nach öffentlicher Konfrontation mit dem Liberalismus erfährt der orthodox gesinnte Pastor Adolph, die gesellschaftlichen Veränderungen als schmerzhaften Umbruch. Seine glückliche Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Heinde endet mit einer Versetzung. Über die wahren Gründe und den Ort seiner Versetzung schweigt seine als Ego-Dokument zu wertende Schrift und regt somit zu Nachforschungen über den Lebenslauf von Heinrich Adolph an.
Biographische Daten
Heinrich Konrad Christian Philipp Adolph, am 17. Dezember 1836 geboren, erlebte seine frühe Kindheit im Pastorenhaus seines Geburtsortes Nordstemmen in der Obhut seiner Eltern. (1) Spät erst, im Alter von dreieinhalb Jahren sprach er sein erstes Wort und kämpfte wohl stets mit "einer schweren, ungefügigen Zunge" (Erinnerungen, S.2).
(1) Mutter: Johanne Dorothe Amalia Adolph, geborene Schmidt (geb. 3.9.1803 in Greene, gest. 4.9.1880 in Hannover). Vater: Johann Heinrich Carl Adolph (geb. 22.2.1801 in Bockenem, gest. 1873 in Heiligenfelde)Als sein Vater 1847 seine Pfarrstelle in Nordstemmen verließ und nach Heiligenfelde übersiedelte, gehörten zur Familie 10 Kinder (2). Heinrich, obwohl erstgeborener Sohn, fiel keine dominante Rolle innerhalb der Kinderschar zu, also auch nicht gegenüber seinen jüngeren Geschwistern.
Zusammen mit seinem um 3 Jahre jüngeren Bruder Karl (3) verließ Heinrich Adolph 1852 das Elternhaus, um das Gymnasium Andreanum in Hildesheim zu besuchen. Obwohl zuvor allein vom Vater unterrichtet, bestanden die Brüder die Aufnahmeprüfung und wurden, wenn auch nicht ohne Vorbehalt, in die Tertia aufgenommen. Heinrich war damals bereits fast 16 Jahre alt.
(2) Innerhalb von 14 Jahren gebar Amalia Adolph 12 Kinder. Zwei Mädchen starben im ersten Lebensjahr. Die in Adolphs "Erinnerungen" aufgeführten Hinweise auf seine Geschwister bleiben undeutlich,ließen sich jedoch anhand von Kirchenbucheintragungen klären.
1857 schrieben sich die beiden Brüder in Göttingen ein. Während Karl die Fächer Mathematik und Naturwissenschaft wählte, entsprach Heinrich dem väterlichen Wunsch und wandte sich der Theologie zu.
1861 schloss Heinrich Adolph sein Studium in Göttingen ab (4) und unterrichtete in den drei folgendeni Jahren als Hauslehrer die Kinder eines Domänenpächters in Vienenburg. Die Leitung einer dort geplanten Privatschule zu übernehmen, reizte ihn offenbar nicht. Der Wunsch, wie sein Vater, Pastor zu werden, führte ihn nach Hannover. Dort absolvierte er 1864 das erste Staatsexamen.
(3) Gottfried Wilhelm Carl Adolph (geb. 8.4.1839, gest. 3.1.1880) Astronom, war 1861 Beobachter am Pulkowa Observatorium (Petersburg) und von1862 bis 1863 ebenso in Königsberg tätig, Er promovierte 1873, führte heliometrische Messungen in Straßburg aus und nahm an der Expedition zur Beobachtung des Venus-Durchgangs vom 9. Dezember 1874 in China teil.
Es folgten zwei Jahre, die er als Hospitant in Loccum erlebte und in denen er eine Ausbildung im Kooperatoren-Seminar in Hannover wahrnahm. Schließlich wurde Adolph als Kollaborator in Himbergen (Lüneburger Heide) eingesetzt. Am 11. 10 1866 traf er dort ein, gewann aber kein Vertrauen in der Gemeinde und litt Monate lang unter psychischer und physischer Belastung.
(4) Zwei Jahre später beginnt der jüngster seiner Brüder, Georg Ernst Adolph (geb. 11. 10.1843, gest. 15.7 1922) an der Geogia Ausgusta Naturwissenschaften zu studieren. Er veröffentlicht 1880 eine Arbeit zur Morphologie von Hautflüglern.
Welchen Umständen er seine erste Pastorenstelle verdankte, ist nicht bekannt, wohl aber, dass er sich im Januar 1867 in Heinde bei Hildesheim mit einer Probepredigt der Kirchengemeinde vorstellte und umgehend die Zusage des Kirchenpatrons (6) erhielt. So konnte er eine seit Jahren vakante Pastorenstelle einnehmen.(7) Am 15. Februar 1867 bezog er, das schöngelegene Pastorenhaus in Heinde, zusammen mit seiner Schwester Charlotte (8), die ihm bis zu seiner "Verheiratung den Haushalt führte". (S.225)
(6) Graf Wallmoden-GimbornWo und wann Pastor Adolph heiratete verschweigt er in seinem Buch. Adolph erwähnt nur, dass seine Frau von 1864 bis 1866 in Mitau, Kurland, als Erzieherin tätig war, Anfang August 1867 ein Mädchen gebar, das im ersten Lebensjahr stirbt, drei weitere Geburten folgen. Die Namen von Ehefrau und Kindern erfährt der Leser der "Erinnerungen" nicht.
(7) Zum Kirchdorf Heinde gehörten die Filiale Listringen, der weit außerhalb von Ortschaften, aus Herrenhau, Wirtschaftsgebäuden und Park bestehende Sitz des Patrons, sowie die ebenfalls abseits gelegene Mordmühle. Zusammen mit den evangelisch-lutherischen Bewohnern der überwiegend katholisch geprägten Dörfer Hockeln, Groß und Klein Düngen, betreute Adolph eine Gemeinde von etwa 1100 Seelen.
(8) Henriette Charlotte Marie Adolph (geb. 20.9.1835 in Nordstemmen)
Trotz mancher Schicksalsschläge zählt Adolph die ersten Jahre seines Aufenthalts in Heinde zu den glücklichsten seines Lebens.
Im August 1869 fand seine strapazierte Gesundheit während eines vierwöchigen Aufenthalts in Karlsbad Erholung. Nach Heinde zurückgekehrt beginnen berufliche Schwierigkeiten, hervorgerufen durch eine öffentlichen Stellungnahme zur Kirchenpolitik. Mit Äußerungen gegen die liberalen Bewegung gerät er in Schwierigkeiten.
Eine Bewerbung um eine Pastorenstelle in Hannover schlägt fehl. In Hildesheim meldet eine Zeitung im Mai 1873, dass sich Pastor Adolph bei seiner "Wahlpredigt in der Aegidienkirche in Hannover" eines Plagiat schuldig gemacht habe.
Von 1876 bis 1879 ist er Pastor in Jerstedt, danach in Bevensen bei Braunschweig.(3) Einzelheiten dazu erwähnt Adolph in seinen Erinnerungen nicht.
1901 vollendet er das Manuskript seiner Lebensbeschreibung, bietet es dem Reichsboten zur Veröffentlichung an, der Teile davon übernimmt, und findet schließlich bessere Möglichkeiten der Veröffentlichung. Im Verlag von Velhagen und Klasing, Bielefeld und Leipzig, erscheinen 1907 die Erinnerungen eines niedersächsischen Geistlichen.
(3) MEYER, Die Pastoren der Landeskirchen Hannover und Schaumburg-Lippes seit der Reformation, Bd. 2
Diese Memoiren, von nicht geringer regional- und sozialgeschichtlichen Bedeutung, brechen in der kritischen Lebensphase unvermittelt ab, erwähnen nur knapp einige geringfügige Ereignisse der Jahre bis 1901. Deshalb erscheint es reizvoll, einigen von Adolph vernachlässigten Punkten nachzugehen.
Werke:
Wie hat sich die Kirche gegen die Verächter der Taufe und Trauung zu verhalten? - Vortrag gehalten auf der Inspektoren-Synode in Lehre. Braunschweig (Wollermann) 1885
Erinnerungen eines niedersächsischen Geistlichen.
Bielefeld, Leipzig 1907
Samstag, 1. Oktober 2011
Bucheckern
Wir hatten Heyersum hinter uns, überquerten die Landstraße und schoben die Räder bergan. Meine Mutter hielt inne und ich hörte sie andächtig den bekannten Liedervers summen:
"Wer hat dich du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben?
Wohl dem Meister will ich loben,so lang' noch meine Stimm' erschallt,
O wie wohl, du schöner Wald."
Jetzt wusste ich , sie hat mir verziehen, zwischen uns ist wieder alles gut.
Als ich vor etwas mehr als einer Stunde von der Schule nach hause kam, stand sie startbereit mit ihrem Fahrrad auf dem Hof.
"Komm mit, wir wollen Bucheckern sammeln."
Ich maulte.
"Na los! Es ist herrliches Wetter. Wir fahren zum Heyersumer Wald."
Nee, maulte ich weiter.
"Na, dann eben nich'. " Schon saß sie auf dem Rad und fuhr los.
Ich ging ins Haus, die Treppe hoch, streifte den Tornister ab und schob ihn mit dem Fuß in die Ecke. Am Kleiderbord hing unser Einkaufsnetz, darin ein dicker Apfel und die Brotschachtel aus Aluminium, die ich bei Schulwanderungen schon so oft dabei gehabt hatte.
Über den letzten Wanderausflug muss ich heute einen Aufsatz schreiben, maulte ich in Gedanken, zerrte den Tornister auf den Tisch in meinem Zimmer. Setzte mich und sah aus dem Fenster.
Auf der Bahnstrecke von Barnten nach Emmerke qualmte ein Personenzug entlang. Die Schranken am Feldweg nach Heyersum waren bereits geschlossen. Es würde noch einige Zeit dauern, dann müsste meine Mutter auch dort ankommen. Noch bewegte sich nichts auf dem Weg. Selbst wenn ich jetzt ganz schnell hinter meiner Mutter herfahren würde, könnte ich sie weder bis zu dieser Schranke, noch bis zur nächsten einholen. Es sei denn sie wären länger als üblich geschlossen.
Das Rennen begann. Hoffentlich muss ich jetzt nicht mein Fahrrad aufpumpen. Die Zeit drängt. Ich fuhr bereits, als ich das Einkaufsnetz an den Lenker hängte und darauf bedacht war, dass es nicht in die Speichen des Vorderrads geriet.
Bis zum Dorfausgang stieg die Straße ein wenig bergan. Zwei drei Ecken weiter lag der schnurgerade Feldweg vor mir und ich sah in der Ferne jemanden auf dem Fahrrad. Bis zum Bahnwärterhäuschen könnte ich die Strecke nicht aufholen. Aber es gab ja gleich dahinter einen zweiten Bahnübergang. Dort an der Nordstemmer Strecke fuhren viel häufiger Züge. Wenn ich Glück habe, wird meine Mutter dort warten müssen. Es kam anders.
Aber noch vor den ersten Häuser von Heyersum war ich auf Rufweite heran gestrampelt. Schreit ein fast Zwölfjähriger Bengel in der Feldmark laut nach seiner Mama? Nein; ich klingelte wie wild und trat kräftiger in die Pedalen, wich geschickt Unebenheiten und Steinen aus, rief "Warte auf mich" und klingelte wieder.
Jetzt schien es als wollte sie sich umdrehen. Tatsächlich sie hielt an, winkte kurz und fuhr einfach weiter. Ich war noch zu weit entfernt. Sie konnte mich noch nicht erkennen und ahnte ja auch nichts von meiner Verfolgungsjagd. Dann war ich bei ihr.
"Na, hast Du es dir überlegt?"
"Ja."
Langsam fuhren wir die Dorfstraße entlang, am Feuerlöschteich vorbei. Rechter Hand vor uns stand das große Gasthaus "Salzburg" an der Landstraße, die wir gemeinsam überquerten. Vor uns lag der Heyersumer Berg. Am Waldweg legten wir unsere Räder ab. Die Buchen brauchten wir nicht zu suchen. Ihre dicken lichtgrauen Stämme umgaben uns.
Das Auflesen der Bucherkern war ein mühsames Geschäft. Ich hatte es geahnt. Zunächst sah ich auch gar keine, überall nur die welken Blättern vom Vorjahr. Doch nach ein wenig hier und dort geschaut, verrieten die stacheligen Hüllen, wo sich das Einsammeln der kleinen dreikantigen Nüsse lohnt. Wir knieten uns hin, schoben mit den Händen das trockene Laub beiseite, denn die meisten und schönsten glänzende Eckern lagen unter den Laub.
Selten allerdings so dicht, dass ich gleich mehrere in die flache Hand schubsen konnte, um dann durch geschicktes Pusten unnütze Krümel zu entfernen. Meistens wollten die braunen Eckern aber einzeln vom Boden aufgelesen werden.
"Du musst sie zwischen den Fingern zusammen drücken, dann kannst du die tauben Schalen wegtun."
Als mir die scharfen Kanten der Bucheckern wehtaten, versuchte ich meine Puste-Methode. Dabei verlor ich allerdings zu viele gute Nüsse.
"Du kannst sie auch essen, ohne Schale natürlich."
Die harte glatte Schale ließ sich mit den bloßen Fingern kaum abspulen. Der Kern schmeckte zwar; war aber "was für den hohlen Zahn", wie man so sagte.
Meine Mutter sammelte die Früchte in einer leere Konservendose, war sie gut halb voll schüttelte sie die Dose und oben bildete sich eine Schicht aus den leichten tauben Eckern, die sich dann leicht entfernen konnte.
Besonders die vorjährigen leeren Hüllen pikten beim knien. Nur die erst kürzlich vom Baum gefallenen hinterließen an den nackten Beinen keine Schrammen, ihre Stacheln waren noch weich. In einigen stecken noch die Nüsse, paarweise jeweils in vier Fächern.
Als wir mit unserer Ernte heimfuhren, hörte ich, dass meine Mutter die Absicht habe bis zum in diesem Herbst noch öfter Bucheckern sammelt wollte. So geschah es auch. Sie drängte mich nicht, sie zu begleiten.
In einem der Nachbardörfer von Rössing gab es ein Ölmühle, und bei uns die köstlichsten Kartoffelpuffer im ganzen Ort.

Freitag, 16. September 2011
Rückblende
Sollte man als alter Mann Orte seiner Kindheit noch einmal aufsuchen?
Ich meine ja; selbst auf die Gefahr hin, dass sich inzwischen veränderte 
Ich bin das Wagnis eingegangen, habe den Versuch unternommen und einen Ort meiner Kindheit aufgesucht und mich der Nostalgie hingegeben.
Einige Tagen zuvor hatte ich Kontakt mit Herrn B. in Rössing aufgenommen, ihm mitgeteilt, dass ich von 1945 bis 48 als Kind zusammen mit meinen Eltern in seinem Haus gewohnt habe und ihm gesagt, wie gern ich noch einmal seinen Hof, meinen einstigen Spielplatz wiedersehen würde. Er zeigte Verständnis für mein Anliegen.
Das Besondere an seinem Grundstück war und ist seine Lage am Rössingbach, Beeke genannt, und die Nähe zum Schlossteich.
Als ich den Hof betrat, erfreute mich der Anblick von zwei Knaben
Nur Unwesentliches hatte sich in den mehr als sechs Jahrzehnten verändert. Viele Details erkannte ich sofort wieder und alles war mit angenehmen Erinnerungen verbunden.
Am Rössinger Schlossteich bin nicht enttäuscht worden, sondern erlebte ein - zwei Stunden lang Glückseligkeit. Zugegeben, emotionsgeladen, mit feuchtem Auge, also sollte ich statt von Glückseligkeit besser von Rührseligkeit sprechen.
Ob, oder wie weit das meine Gedächtnisinhalte veränderte, Erinnerungsbilder aufgefrischt wurden, vermag ich nicht zu sagen. Wesentliches ist auf dem Hof geblieben wie es war.

"Die Gänse sind ja auch noch da", staunte ich und machte mich innerlich schon bereit ihnen gegenüber meine Anwesenheit zu behaupten. Belehrt, dass es sich um Wildgänse handeln würde, wollte ich mich langsam an sie heranpirschen, sie fotografieren. Das misslang. Ohne Gezeter machten sie den Platz frei, begaben sich auf den Teich und schwammen davon. Die Hausgänse von damals waren nicht so zahm, sie hätten mich mit vorgestrecktem Hals attackiert. 
Bäuchlings im Gras liegend, mit dem Gesicht dicht über dem Wasser, konnte ich auf diese Schlammschicht schauen, sah aufmerksam zu, was sich dort abspielte. An den meisten Uferstellen gelang das nicht, weil dort ein dichtes Paket von Fadenalgen wuchs oder weil die Kante des Ufers zu hoch und damit der Abstand bis zum Wasser zu groß war.
Dort konnte ich bestenfalls auf das Algenpaket sehen, auf dessen grüner Oberfläche Insekten saßen und anderes Kleingetier herumkrabbelte. Junge Augen sind oft kurzsichtig, deshalb ließ sich manches Detail ohne Lupe, die mir ohnehin nicht zur Verfügung stand, bei geringem Abstand gut erkennen.
Was ich im einzelnen alles beobachte erinnere ich nicht, weiß aber, dass es mir niemals langweilig wurde.
Im Frühjahr 1945 hatte es mich nach Rössing verschlagen. Der fiel aus, begann erst im Sommer 1946. Ich erlebte die längste und sorgloseste Ferienzeit meines Lebens. Über die von mir im Schlossteich entdeckte Wunderwelt erfuhr ich in der Rössinger Volksschule leider fast nichts. Erst als wir ein Radio bekamen, damals waren wir innerhalb des Dorfes in eine Mietwohnung umgezogen, weit entfernt von Beeke und Schlossteich, lernte ich Einzelheiten über die heimische Flora und Faune durch den Schulfunk kennen. Als gedruckte Informationsquelle kam der Schulfunk-Bilderdienst hinzu.
Ein Beitrag über die Teichmuschel ermunterte mich, sie in natura zu beobachten, näher zu untersuchen. Ihre Schalen waren an vielen Uferzonen leicht finden.
Einmal habe ich eine Muschel an meine Beobachtungsstelle "umgesiedelt", konnte in den folgenden Tagen zusehen, wie sie sich am Grunde langsam fortbewegte. Aus dem Schulfunk wusste ich, was dabei geschieht, wie sie das bewerkstelligt. 
Diesmal saß ich auf einen bequemen Gartenstuhl blickte auf die ruhig dahin schwimmende Schar der schönen Wildgänse und die zielstrebig auf mich zukommenden Futter erwartenden Enten, sah die kaum bewegte Wasserfläche, auf der sich die Bäume des gegenüberliegenden Ufer spiegelten und das rote Ziegeldach sowie die goldgelb gestrichene Fassade des Schlosses leuchteten.


Eine deutliche Veränderung ist mir aufgefallen, die einst üppig wuchernden Fadenalgen sind von Teich verschwunden. Zeigt ihr Fehlen eine, gegenüber den 50er Jahren verbesserte Wasserqualität an? Wasserlinsen sah ich ebenfalls nicht, statt dessen schien mir das Wasser trüber zu sein als zur Zeit meiner Kindheit.
Diese Trübung mag aber jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen zu sein. Was es damit auf sich hat, werde ich bei gelegentlichen erneuten Besuchen heraus finden. Als ich mich damals über das Wasser beugte, um zu sehen, was sich am schlammigen Boden abspielt, muss das Wasser klar gewesen sein. Sonst hätten sich Erinnerungen an die verschiedenen Einzelheiten, die Teichmuschel, über deren "Atemloch" sich kleine Schwebeteilchen hin und her bewegten, nicht im Gedächtnis verankert. Ebenso wenig jene Bilder der Unterwasserwelt, die mich an einen Wald denken ließen, in dem ein kaum fingerlanger Hecht auf Beute wartete. Um solche Einblicke in die Unterwasserwelt zu bekommen, war es manchmal erforderlich, die dichte schwimmende Decke der Fadenalgen beiseite zu schieben. Vorsorglich schuf ich mir wohl auch für die nächsten Tage solche Beobachtungsfenster im Algenteppich. Am besten eignete sich dafür ein rauer Stock, besser noch das handliche Stück einer groben Holzlatte, damit konnte man die Algenfäden aufwickeln. Vorsichtig und langsam, um keinen Schlamm aufzuwirbeln, zog ich den Wickel heraus und schleuderte ihn an Land. Er triefte vor Wasser, roch intensiv, typisch nach Teich und Mudde. Mit den Algen landeten zugleich etliche Kleintiere auf dem Ufer. Sie zappelten und krabbelten um ihr Leben, wollten nicht im Trockenen sein. Besonders Auffällige, etwa Schnecken oder Schwimmkäfer setzte ich oft wieder zurück, beobachte sie noch eine Weile so gut das im Teich ging, sperrte sie aber dazu auch manchmal in ein Weckglas ein; so begann meine erste lockere Hinwendung zur Aquaristik. Ich erinnere mich auch an Tierchen, die wir Asseln nannten. Es wird sich dabei aber um Insektenlarven gehandelt haben.
Es war für uns Kinder kaum möglich über die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten Einzelheiten zu erfahren.
Die Erwachsenen, einschließlich der Lehrer hatten durch die Kriegsfolgen "weiß Gott" andere Probleme, als uns die im Gewässer lebenden Tiere näher zu bringen. Die meisten Menschen hätten ohnehin nur Interesse daran gezeigt, soweit diese Tiere essbar und nahrhaft waren. So lernten wir zwar grob einige Fischarten kennen, konnten Hechte und Rotfedern unterscheiden, erfuhren wohl auch, dass der eine ein Raubfisch, die anderen aber Friedfische seien, und lernten, dass eine andere, aus damaliger Sicht wichtigere Einteilung kennen. Nämlich eine Ordnung entsprechend der Begehrlichkeit, Nützlichkeit. Fünf dicke Rotfedern, ergaben eine Mahlzeit, ein halbwüchsiger Hecht bescherte dem Angler zwar ein wenig Aufmerksamkeit, machte aber nicht satt. Nur wenn er einen ausgewachsen fing, erntete er Bewunderung und eine Mahlzeit. Als Information musste das dem Dorfkind vorerst genügen.
Wer etwas lernen will "muss mit den Augen stehlen" hörte ich meinen Stiefvater sagen. Er (Heinrich Zeuner, geb. 1882 in Lauenau am Deister) stammte aus einer kleinbäuerlichen Handwerkerfamilie. Bei praktischen Tätigkeiten mag dieser Spruch noch immer Bedeutung besitzen. Irgendwann genügte mir das ausschließliche Beobachten nicht mehr.
Ein Beitrag im Schulfunk-Bilderdienst behandelte den Bitterling und seine Lebensgemeinschaft mit der Muschel.
Teichmuscheln gab es in Rössinger Gewässern häufig, aber von einer Fischart Bitterling wussten selbst die erfolgreichsten Angler nichts zu sagen. Als ich einem einmal sagte, der Bitterling würde seine Eier in die Teichmuschel legen fand ich kaum Gehör, merkte wie unterschiedlich unser beider Interessen offenbar waren.
Es wäre fast ungewöhnlich für einen Jungen meines Alters in Rössing nicht irgendwann auch einmal zur Angel gegriffen zu haben. Die Beeke oberhalb des Mühlenwehrs und der Mühlenkolk bis zur Pferdeschwemme waren die beliebtesten Angelplätze; nicht aber Teich und Schlossgraben. Sie wurden aus Respekt vor dem Baron oder dessen Gutsverwalter weitgehend gemieden.
Die als Angelruten bei der Jugend begehrten Haselnusstriebe wuchsen im Schlosspark, gleich hinter der Mauer, also auf verbotenem Terrain, glücklicherweise vom Schlossgebäude nicht einsehbar. Ich wagte mich auf das Parkgelände. Mein Vater hatte mir mir sein Taschenmesser anvertraut. Schnell ergatterte ich eine schöne gerade Haselnussrute. Zuhause im Nähkasten gab es schwarzen Zwirn. Etliche Stecknadel verbrauchte ich, bis es mir gelang einen geeignet erscheinenden Haken zu biegen. Jetzt fehlte noch der Schwimmer. Einen Korken zu finden, ihn zu durchbohren stellte die größte Schwierigkeit beim Anfertigen meiner Angel dar. Dann war schnell alles verknotet, zuerst der Zwirnsfaden, durchs Korkenloch gezogen und mit einem Federkiel fixiert. Innerhalb eines Tages stand ich als Angler an der Beeke. 
So klein sie auch waren, meine Mutter briet sie für mich. Nie hätte ich geglaubt, dass die Winzlinge so viele Gräten haben könnten. Ich hätte sie besser im Bach lassen sollen. Angeln war nicht meine Sache.
Montag, 25. Juli 2011
Traurigkeit
Es is' ja, wi's is' - nämlich sehr sehr traurig:
In Oslo wütete ein durchgeknallter Massenmörder,
in China stürzt ein Hochgeschwindigkeitszug von einer Brücke,
gestern jährte sich die Loveparade-Katastrophe,
in Ostafrika verhungern Menschen,
Wolfgang Joop trennt sich in Berlin von einer seiner Villen,
Amy Winehouse ist tot,
Sebastian Vettel verpatzt Podiumsplatz am Nürburgring.
Als kärgliche Lichtblicke müssen herhalten:
- Der SV Algermissen qualifiziert sich fürs Halbfinale der Kreisliga,
- Schalke 04 hat gewonnen.
Was bleibt sind Trostpflaster und die fünf altbekannten Heilmittel gegen Traurigkeit:
Tränen, das Mitleid der Freunde, die Betrachtung der Wahrheit, schlafen und träumen.
Donnerstag, 19. Mai 2011
Teebeutel-Schleuderei
 In meiner Kindheit galt die Aussage "Ich will ..." bereits als kritikwürdig. "Ich hätte gern ..., ich wünsche mir ...", artig noch das Zauberwort "bitte" hinzugefügt, war die einzige akzeptable Form einen Wunsch zu äußern. Gegenüber einer Forderung mit starker Willensbekundung hatte damals nur eine höflich zurückhaltende Formulierung in unsere Gesellschaft die besten Chancen. Niemand wollte mit seinem Wunsch Unbescheidenheit zum Ausdruck bringen. Oft hielt ich mich daran. Bis eines Tages ein mir wohlgesonnener Vorgesetzter, meine Zurückhaltung absonderlich fand.
In meiner Kindheit galt die Aussage "Ich will ..." bereits als kritikwürdig. "Ich hätte gern ..., ich wünsche mir ...", artig noch das Zauberwort "bitte" hinzugefügt, war die einzige akzeptable Form einen Wunsch zu äußern. Gegenüber einer Forderung mit starker Willensbekundung hatte damals nur eine höflich zurückhaltende Formulierung in unsere Gesellschaft die besten Chancen. Niemand wollte mit seinem Wunsch Unbescheidenheit zum Ausdruck bringen. Oft hielt ich mich daran. Bis eines Tages ein mir wohlgesonnener Vorgesetzter, meine Zurückhaltung absonderlich fand. Er trat mit einem Karton auf eine kleine Gruppe seiner Mitarbeiter heran und verteilte Exemplare einer vom ihm herausgegeben kleinen Schrift. Alle drängten sich vor. Ich hielt mich zurück. Dann sah ich, dass sich im Karton nur noch zwei Büchlein befanden, zögerte einen Wimpernschlag mit dem Zugreifen, und ging ich leer aus. Als der Autor seine letzten Belegexemplare verteilt hatte, muss mir wohl meine Enttäuschung im Gesicht gestanden haben. Er sagte im väterlich freundlichen Ton und einem Achselzucken zu mir: "Braves Kind fragt nicht - braves Kind bekommt nichts."
"... und dabei hätte ich so gern ihr Buch gelesen."
Am nächsten Tag lag eins in meinem Postfach. Danke lieber Dr. K. Sie haben mir die Augen geöffnet.
Sogenannte Bescheidenheit, ein freiwilliger Verzicht zu Gunsten anderer, noch dazu solchen, die sich selbst in den Vordergrund schieben, führt nicht immer direkt zum Ziel, bestenfalls zu Anerkennung und Wertschätzung. Immerhin, das ist sehr viel!
Da sich die allgemeinen Umgangsformen in vielen Bereichen veränderten, blieb auch ich nicht immer bei Bescheidenheit und Höflicheit. Dennoch als Fundament sind solche Tugenden nicht wegzudenken.
Wohl deshalb ich bin enttäuscht, wenn erlebe, dass ein junger Radfahrer auf dem Gehweg klingelnd an einem am Stock gehenden Opa vorbei zieht. Bin beruhigt, dass der Alte nicht hinterher schreit "Radfahren verboten" sondern zur Vermeidung von Konfrontationen rechtzeitig beiseite ging.
Ein "Danke" aus dem Munde des Jünglings würde mich hoffnungsfroh stimmen.
Es is' ja, wi's is'
Ein philosophisches Wort von allumfassender Bedeutung.
Eine Binsenweisheit, ähnlich wie: 'Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt' (Laotse / Laozi, 6.Jh.v.Chr.)
Stefanis Gesellschaft möchte ich zu folgenden Gedankengängen verleiten.
Dem Ziel einer Reise nahe ist der erste Bewegungsimpuls oft von vielfältigen Reiseeindrücken überlagert und dem Gedächtnis entschwunden. Das gilt erst recht bei der Betrachtung des Lebensweges. Erinnerungen an die eigene Lebensreise mögen weit zurückreichen. Aber sicherlich nicht bevor das fünfte Lebensjahre erreicht wurde. Handelte es sich dabei um den ersten bewussten Schritt; begann damals die bewusst erlebte Reise? Undeutliche Erinnerungen mögen aus dieser Zeit abrufbar sein; oder sind Rückblicke auf solche Abschnitte des eigene Daseins gar nicht möglich und wenn doch, wie wahrheitsgemäß sind sie? Was blieb in Erinnerung, was wurde ausradiert oder leicht verändert überschrieben?
Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. „Der Weg ist das Ziel“, könnte man glauben und eine stete Veränderung als Lebensziel vorschlagen. Es sei denn man kennt Melvilles Wort: "Life's a voyage that's homeward bound." Doch eine Reise, die heimwärts führt, kann nur Bedeutung für jene erlangen, die ein Zuhause besitzen oder an dessen Existenz glauben.
Die Vorstellung nach dem Tode heimzukehren, ist in unserem Sprachgebrauch fest verankert. Sie mag schon sehr früh in der Geschichte menschliches Wunschdenken beeinflusst haben. Allein schon, um dem Tod den Schrecken zu nehmen.
Andererseits könnte aus dem Glauben an ein, wie auch immer geartetes Fortleben nach dem Tode, dem Glauben an Wiedergeburt, Auferstehung in Geborgenheit, eine Todessehnsucht erwachsen. Die Aufnahme ins Paradies ist nicht kostenlos zu haben. Man muss sie mit dem Leben bezahlen. Losgelöst von religiösen Dogmen mögen auch Überlegungen auftauchen, dass ein ewiges Fortbestehen atomarer Substanz, in einem Kreislauf mündet. Atome aus denen schließlich alle Lebewesen bestehen und die selbst nach dem Weg durch Feuer, sogar nach kosmischer Durchmischung und stellarer Neuordnung aller Elemente Bestand bewahren, retten uns, zumindest Teile unseres Körpers vor dem endgültigen Auslöschen. Das ist ein Gedanke, dem sich vielleicht jene hingeben, denen eine leibliche Auferstehung am Ende aller Tage, als Horrorvision erscheint und denen die abgemilderte Form, die immaterielle Auferstehung, das Fortleben der Seele, sympathischer ist. An dieser Stelle höre ich einen Zwischenruf in Stefanis Theke: "Meinste Seelenwanderung! Oder was?"
Alles kann auch vollkommen anders sein, als menschlicher Geist sich vorzustellen vermag. Platon öffnete uns mit seinem Höhlengleichnis die Augen. Danach wäre alles während der Lebensreise Gesehene als Trugbild zu werten; welchen Stellenwert dürfen wir dann dem ganzen Geschehen zugestehen?
Die überschaubare Etappe des Lebens endet mit dem Tod. Ein Abschnitt ist erreicht. Das war's dann. Für tiefgründige Fragen hat die NDR2-Comic-Figur Stefanie eine passende Antwort parat. Sie sagt den Gästen ihrer Stehimbissbude: „Es is’ wi’s is’."
http://www.podcast.de/episode/2081917/E10
-------------